Nathan der Weise
Ein dramatisches Gedicht in fünf Aufzügen | von Gotthold Ephraim Lessingmit englischen Übertiteln
»Sind Christ und Jude eher Christ und Jude als Mensch?«
Jerusalem im 12. Jahrhundert während der Zeit des dritten Kreuzzuges: Der Jude Nathan kehrt von einer Geschäftsreise zurück. Da erfährt er, dass sein Haus gebrannt und seine Tochter Recha nur wie durch ein Wunder überlebt hat. Ein christlicher Tempelherr rettete das Mädchen aus den Flammen. Als Nathan ihm persönlich danken möchte, reagiert der schroff. Er möchte als Christ nicht mit einem Juden verkehren. Doch da er eigentlich ein feinsinniger, kluger Mann ist, verschließt er sich Nathans Argumenten nicht, dass sie beide doch in erster Linie Menschen seien und dann erst Angehörige ihrer Religion. Als der Tempelritter dann auch noch Recha wiedertrifft, verliebt er sich sofort und hält bei Nathan um ihre Hand an. Doch warum weicht Nathan ihm aus? Daja, das Dienstmädchen des Juden, verrät ihm schließlich, dass Recha nur die angenommene Tochter Nathans und eigentlich auch Christin sei. Eine Tatsache, die den Tempelherrn zutiefst empört und die er seinem geistlichen Oberhaupt, dem Patriarchen, zuträgt. Für den steht auf diesen »Raub« eines Christenkindes aus der religiösen Gemeinschaft ganz klar die Todesstrafe. Unterdessen hat Sultan Saladin den überall als Weisen gepriesenen Nathan zu sich gebeten. Er möchte von ihm wissen, welche Religion er für die wahre halte. Nathan erzählt ihm darauf die Parabel von einem Ring, der die Eigenschaft habe, vor Gott und den Menschen beliebt zu machen. Die »Ringparabel« ist als eines der wichtigsten Plädoyers für die Ebenbürtigkeit der drei Weltreligionen in die Literaturgeschichte eingegangen. Eine Religion muss ihre Werte hier und heute leben. Nur im humanen Handeln, in der gelebten sozialen Praxis erweist sich ihr Bestand.
Lessings Nathan gilt als die Gestalt gewordene Idee von Toleranz und Nächstenliebe. Er ist ein Mensch, der in seinem Leben geliebt und gelitten hat, und der von vielen schrecklichen Erlebnissen geprägt wurde. Nathan weiß: Es gibt keine Alternative zur Vernunft. Er verkörpert den aufgeklärten Menschen, der seinem Verstand vertraut und auch andere von dessen Benutzung überzeugen will. Damit gilt »Nathan der Weise« als ein Hauptwerk der Aufklärung. Das friedliche Miteinander der Kulturen und Religionen und das Verständnis füreinander ist existentiell und auch heute eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. 2008 eröffnete Axel Vornam seine Intendanz mit »Nathan der Weise« – damals in der Inszenierung von Alejandro Quintana. Nun, 18 Jahre später, zum Ende seiner Intendanz am Theater Heilbronn, möchte Vornam das Stück erneut auf seine Aktualität hin befragen.
For the English version of this page CLICK HERE.

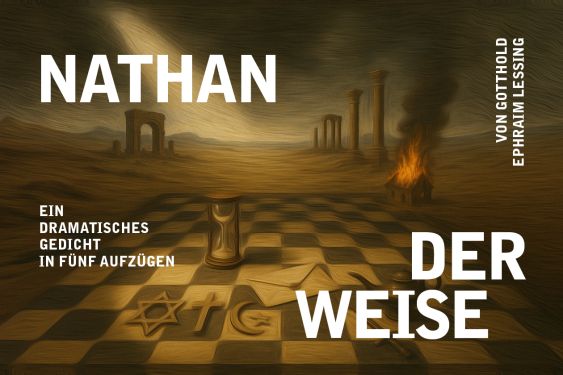
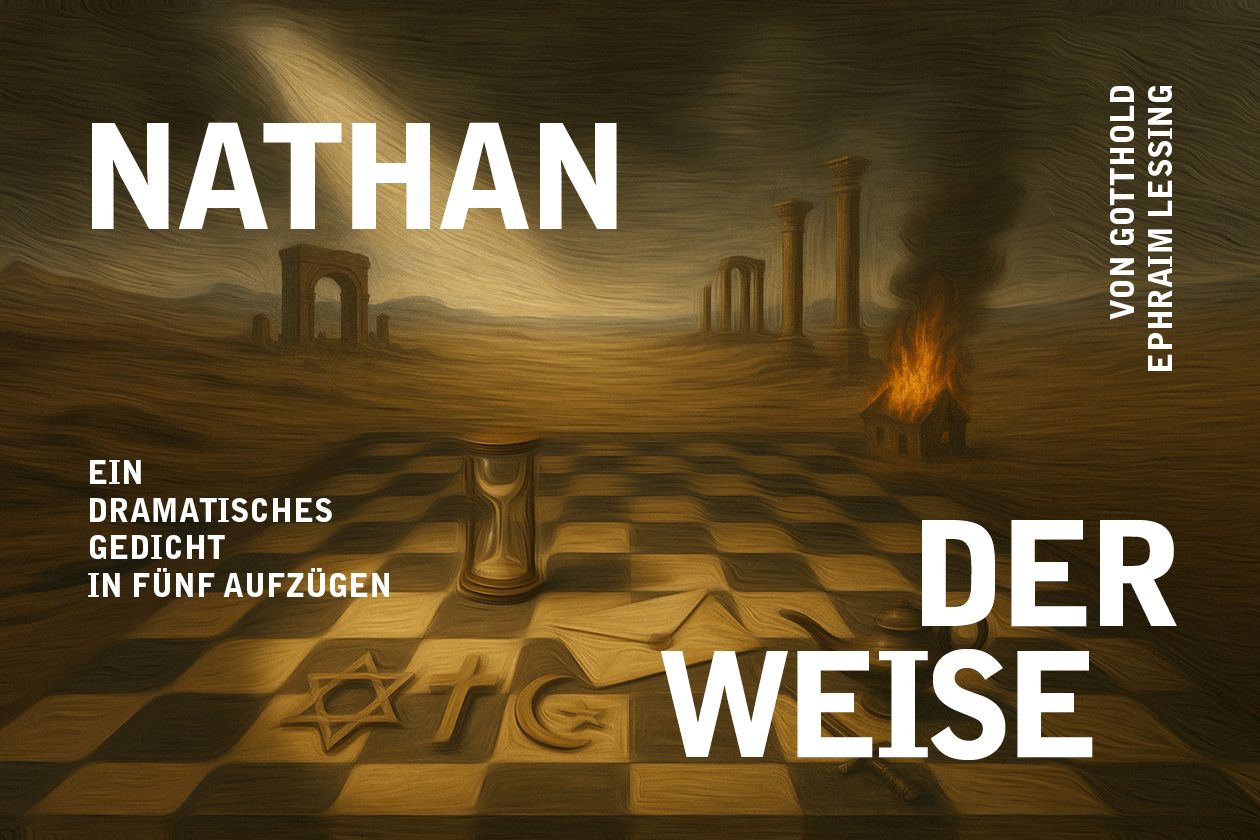
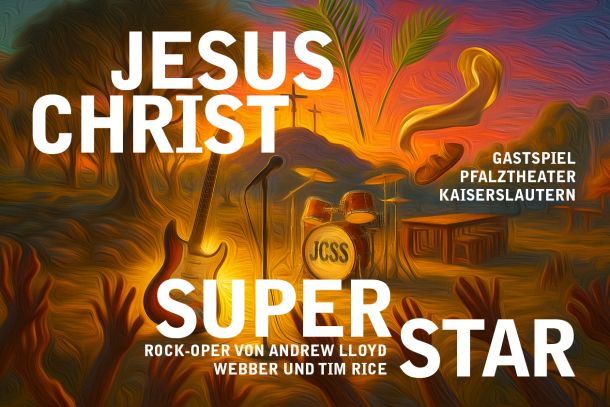 27.03.2026
27.03.2026  03.02.2026
03.02.2026  07.02.2026
07.02.2026